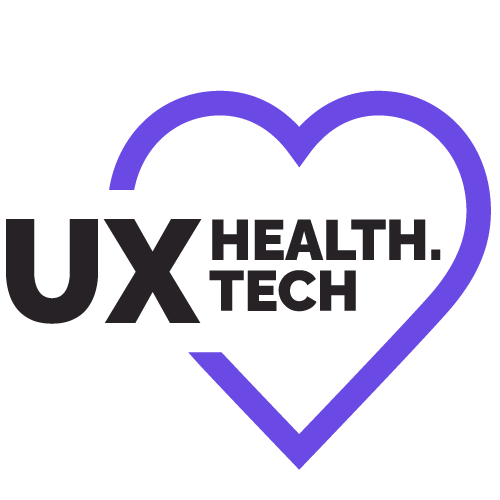Angeregt durch den DiGA-Report des Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung nach dem 69% der Einlösungen von Frauen stammen, diskutieren Ariane Vogel, Ramona Kaiser und ich aktuell das Thema DiGA und Gender auf LinkedIn.
Aus der Community haben wir schon viele aufschlussreiche Hinweise bekommen, um das Thema besser verstehen zu können.
Ich möchte in diesem Artikel meine aktuellen Erkenntnisse einmal zusammenfassen und daraufhin ein paar Metriken vorschlagen, um die Gender-Frage weitergehend erforschen zu können.
Schritt 1 – Daten bereinigen
❗️ Um besser zu verstehen, ob wir ein generelles Anreizproblem bei den Männern haben oder das Problem vielleicht doch an anderer Stelle liegt, müssen wir erst einmal hinterfragen, ob Männer überhaupt die Zielgruppe sind und die Daten entsprechend bereinigen!
💡 So gab Mark Langguth zu bedenken: „Sind alle DiGAs für beide einsetzbar? Vermutlich gibt es auch die eine oder andere speziell für Frauenthemen. Die Daten müssten also erst einmal danach „bereinigt“ werden…“
📊 Mit „HelloBetter Vaginismus Plus“ und der „Endo-App“ (Endometriose) gibt es zumindest zwei Anwendung im DiGA-Verzeichnis des BfArM, die sich schon per se durch die behandelten Krankheitsbilder ausschließlich an Frauen richten. Die Brustkrebs-Anwendung „optimune“ richtet sich ebenfalls ausschließlich an Frauen, während „PINK! Coach“, „untire“ und die inzwischen gestrichene „Cankado Pro-React Onco“ grundsätzlich für weibliche und männliche Brustkrebspatient:innen offen sind. Hier handelt es sich allerdings auch um eine bei Männern eher seltene Erkrankung. Damit haben mindestens 6 der 60 Anwendungen im Verzeichnis einen deutlichen Fokus auf Frauen. Mit „Kranus Edera“ (Erektionsstörrungen) ist wiederum eine DiGA nur an Männer gerichtet.
Schritt 2 – Zielgruppe und Bedarf verstehen
❗️ Im nächsten Schritt müssen wir dann schauen, ob wir ggf. ein Zielgruppenproblem im Sinne eines mangelnden Interesses von männlichen Patienten haben. Wir haben zur unterschiedlichen Krankheitswahrnehmung und zum Hilfesuchverhalten bereits im letzten Artikel ein paar Studien zitiert. Frauen sind hiernach zumindest bei psychischen Themen betroffener, aber auch aktiver im Hilfesuchverhalten. Ergänzende Hinweise kamen aus der Community:
💡 Marcel Weigand berichtete: „mich wundert es nicht. Frauen sind oft die „Gesundheitskümmerinnen“ in Familien, dass sieht man beispielsweise auch daran, dass bei der UPD mehr Frauen als Männer anrufen (bzw. angerufen haben als es die UPD noch gab), oft auch für die Probleme/ Fragestellungen der anderen Familienmitglieder.“
💡 Miriam Moser ergänzte: „Frauen gehen im Durchschnitt etwa 20 Mal pro Jahr zum Arzt, während Männer nur etwa 14 Mal pro Jahr den Arzt aufsuchen. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gehen 67 Prozent der Frauen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, im Vergleich zu nur 40 Prozent der Männer. Diese Unterschiede im Gesundheitsverhalten könnten erklären, warum Frauen häufiger digitale Gesundheitsanwendungen nutzen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele dieser Anwendungen, insbesondere im Bereich der mentalen Gesundheit, von Frauen bevorzugt werden, möglicherweise aufgrund von unterschiedlichen Wahrnehmungen und Barrieren in der Männerwelt.“
💡 Daniela Nippraschk gab auch zu bedenken, dass der Behandlungsfokus vieler DiGAs psychotherapeutisch ist: „25 von derzeit 60 DiGAs sind der Kategorie „Psyche“ zugeordnet. Und die Versorgung der mental Health wird nach wie vor mehr von Frauen in Anspruch genommen. Dies könnte ich mir als einen der Gründe des Gender Gaps der Nutzung erklären.“
📊 Die entsprechende Metrik wäre nun genauer zu schauen, wie viele Männern und Frauen bei dem jeweiligen Thema der DiGA generell Hilfe suchen oder sogar nach zusätzlichen Behandlungsangeboten wie DiGAs fragen? Sind Frauen hier aktiver, haben wir möglicherweise ein Zielgruppenproblem, dem mit Aufklärung begegnet werden könnte!
Oder gibt es vielleicht herkömmliche andere Methoden, mit denen Männer schon gut versorgt sind, für Frauen aber durch die DiGAs eine Lücke geschlossen werden kann, sodass der Bedarf hier einfach höher ist?
Schritt 3 – Auf Benachteiligungen prüfen
❗️ Einem Beitrag von Inga Bergen folgend seien Männer im psychotherapeutischen Bereich allerdings nicht gut versorgt.
💡 Auf die Ergebnisse des DiGA-Reports hin schrieb sie: „Neueste Stichproben zeigen übrigens, dass insgesamt über 2/3 Frauen mit DiGA erreicht werden – und nur ca. 29% Männer – was schade ist, und auch daran liegt, dass ein Großteil der DiGAs im Bereich Psych anzusiedeln sind, und Männer hier seltener Hilfe bekommen – man kann von Diskriminierung sprechen.“
📊 Eine Metrik, um eine mögliche Benachteiligung zu prüfen, wäre auf die zuvor genannte Metrik aufbauend zu schauen, welcher Anteil an hilfesuchenden Frauen und Männern nun die DiGA tatsächlich verschrieben bekommt und wem sie quasi verwehrt wird.
☝🏼 Hierbei ist natürlich Vorsicht geboten: Wenn sich zeigt, dass nicht jede:r Patient:in ein „DiGA-Typ“ (nicht jedem liegt eine digitale Therapie) ist, haben die verschreibenden Ärztinnen und Ärzte idealerweise auch einfach das entsprechende Feingefühl und es sollte sich dann um keine systematische Benachteiligung handeln.
Schritt 4 – Genderbiase in UX-Design und Behandlungsmethodik evaluieren
❗️ Schließlich können wir auch ein UX-Problem haben. Ich erwähnte gerade schon: Nicht jedem liegt eine digitale Therapie!
📊 Metriken wären:
– Wie ist der Anteil der Einlösungen bei Männern und Frauen nach Verschreibung?
– Wie sehen die Abbruchquoten nach Einlösung bei Männern und Frauen aus?
❓ Aber wie motiviert man durch entsprechendes UX-Design und Behandlungsmethodik Frauen und Männer, die DiGA nach Verschreibung auch einzulösen und sie dann auch entsprechend der vorgesehenen Behandlung regelmäßig zu nutzen?
Zu diesem Thema bald mehr! 😉
Kommentieren
Kommentare und Anregungen sammeln wir auf dem zugehörigen LinkedIn-Post.